
Den November haben wir als Familie auf Gran Canaria verbracht – die erste Elternzeit ohne Camper. Und irgendwie auch ohne Reise. Obwohl wir in einem anderen Land waren, fühlte sich dieses Unterwegssein nicht nach Tourismus oder Entdecken an, sondern eher nach einer Workation mit Kindern; nach Alltag an einem anderen Ort, nach der perfekten Kombination aus Arbeit, Urlaub, Familien- und Freundschaftszeit. Und das alles bei 28 Grad im November, jeeiii.
Workation mit Kindern





Vor zwei Jahren waren wir bereits – ebenfalls im November – auf Gran Canaria. Eigentlich fliegen wir nicht gern. Und eigentlich interessiert uns kulturell + landschaftlich eher der hohe Norden als der staubige Süden. Trotzdem hat es uns wieder auf die spanische Insel verschlagen. Und zwar aus gutem Grund! Genau genommen waren es drei Gründe:
1. hatten wir uns für das Jahr 2023 vorgenommen, nur an uns bekannte Orte zurückzukehren und nicht an Neue zu reisen.
2. Lebt eine meiner besten Freundinnen in Las Palmas und die Vorstellung, für drei Wochen gemeinsam Alltag teilen zu können, hat schon im Vorfeld zu Freudentränen bei mir geführt.
Und 3. brauchten wir ein Reiseziel für diese Elternzeit, bei dem ich mich sicher genug fühlte, um einen Großteil des Tages allein mit einem Ein- und einem Zweijährigen zu verbringen. Denn dieser Elternzeitmonat stand unter dem Motto „Endspurt Promotion von Ehemann T“, der entsprechend viel Zeit vor dem Laptop verbrachte während ich mit Klein P und Mini O in der Großstadt unterwegs war… auf der Suche nach Pistazien-Croissants, neuen Spielplätzen oder einem freien Platz unter einer der weniger Palmen am Strand. Das war manchmal sau herausfordernd, überwiegend aber super spaßig.
Vom Traum, Surfer Girl zu werden





Insgesamt hatten wir drei unterschiedliche Unterkünfte in Las Palmas. Eines dieser Apartments lag in erster Reihe zum Meer. Egal, aus welchem Fenster wir blickten, wir hatten immer Wellen und Surfer im Sichtfeld. Dieser Ort brachte einen fast vergessenen und längst eingestaubten Wunsch von mir zum Vorschein, nämlich dem Traum, Surferin zu sein. Ich erinnere mich leider nicht mehr, wie dieses Anliegen in mir entstanden ist. Vielleicht habe ich als Teenager zu oft das Buch Soul Surfer von Bethany Hamilton gelesen oder zu häufig The Beach Boys im Auto meines Vaters gehört. In den letzten Jahren hatte ich auf jeden Fall nicht mehr an den Wunsch gedacht.
Aber hier in Las Palmas bestand mein Umfeld quasi fast nur aus gut-aussehenden Menschen, die ihre Bretter ins Wasser trugen… und die mir damit meinen Kindheitstraum zurück ins Herz brachten.
Im ersten Moment sah für mich die Umsetzung ziemlich easy aus. Ich müsste mich nur für einen Schnupperkurs in einer der Surfschulen in unserer Straße anmelden und meine Mittagspause – die ich bis Dato allein am Strand unter Sonne verbracht hatte – im Wasser statt faul auf dem Handtuch verbringen. Easy, sag ich ja.
Verbunden mit den Wellen. War ich noch nie.


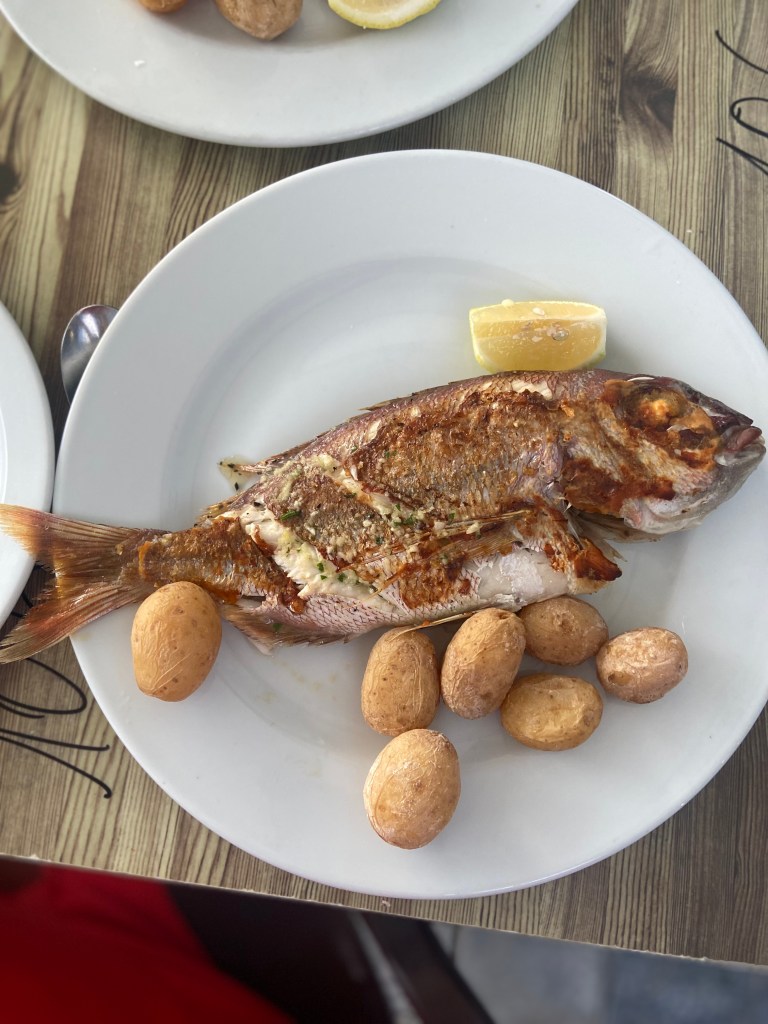
Doch dann stellte ich mir vor, dass ich das tatsächlich tun würde; dass ich die kommenden Tage nicht mehr an meiner Bräune arbeiten würde, sondern mich im Neoprenanzug ins Wasser werfen würde. Nichts daran war attraktiv für mich: Weder der enganliegende, schwarze Anzug, noch das salzige Wasser und erst recht nicht die Wellen.
Keine 10 geschenkten Margaritas würden mich dazu bringen, mich in diese Wellen zu stürzen. Nicht, weil es zu kalt war, sondern weil es mir wortwörtlich zu wellig war. Zu hoch. Zu unruhig. Fürs Surfen perfekt. Für mich nicht.
Ich mag es nicht, wenn mir Wasser ins Gesicht spritzt, ich von der Wucht des Meeres untergetaucht werde und sich Wasser in meinen Ohren sammelt. Ich bevorzuge ruhige Gewässer, in denen ich gemütlich ohne Hindernisse schwimmen kann. Ich bin nicht eine von denen, die sich verbunden mit den Wellen fühlen; deren Kraftort das Meer ist. Ich atme in Wäldern durch und komme an Seen zur Ruhe.
Offensichtlich bringe ich nicht die besten Voraussetzungen für diesen Sport mit. Wenn ich ganz ganz ganz ehrlich wäre, würde meine Vorstellung in einer der Surfschule in etwas so klingen:
„Hola, me llamo Annabel. Ich mag keine Wellen. Aber würde gern surfen lernen. Und am liebsten schnell. Weil ich möchte nicht viel Zeit in diesem Wasser verbringen. Aber ich hätte gern ein paar gute Fotos von mir. Für Instagram. Und ich würde gern ein bisschen von eurem lässigen Surfer-Vibe haben, ginge das? Danke!“
Wahrscheinlich hätte ich mich damit nicht für den letzten freien Platz im Schnupperkurs qualifiziert.
Die Freiheit, etwas sein zu lassen





Ich liebe es, Dinge auszuprobieren, es einfach mal zu machen, Fehler zu machen, nicht auf irgendwann zu warten, sondern Möglichkeiten wahrzunehmen und in die Umsetzung zu gehen.
Aber beim Thema Surfen durfte ich feststellen, dass es auch Dinge gibt, da muss aus einem Irgendwann kein Jetzt werden – da darf aus einem Irgendwann auch ein Nie entstehen.
Insbesondere dann, wenn es einfach überhaupt nicht zu mir passt. Ich wollte Surfen immer nur können, um ein bestimmtes Image zu haben und den lässigen Vibe mitzunehmen. Aber ich wollte Surfen nie um des Surfen willen lernen. Ich mag nämlich gar keine Wellen😆.
Ehrlicherweise gibt es einige solcher Themen in meinem Leben, bei denen ich nicht wegen einer Sache selbst aktiv werde, sondern weil ich mir davon ein bestimmtes Gefühl erhoffe. Ich glaube, wir alle kennen das: „Ich möchte den nächsten Karriereschritt schaffen, nicht um der Erfahrung wegen, sondern um anerkannt zu sein.“ oder „Ich möchte deine Freundin sein, nicht um deiner selbst willen, sondern wegen der Zugehörigkeit, die ich mir durch dich erhoffe.“
Es ist ziemlich peinlich, sich selbst so auf die Schliche zu kommen. Aber irgendwie auch befreiend. Denn ich lerne dadurch, manches lieber nicht zu tun, als es mit der falschen oder einer fragwürdigen Motivation zu versuchen.
Ich habe oft das Gefühl, jede Chance ergreifen zu müssen, die vor meinen Füßen liegt. Aber viel befreiender, als sie zu ergreifen, ist die Erkenntnis, es nicht tun zu müssen.
Manche Menschen brauchen Mut, um etwas anzupacken oder auszuprobieren. Ich hingegen brauche manchmal den Mut, genau das nicht zu tun. Den Mut, mich dagegen zu entscheiden, obwohl es möglich ist.
Genau diesen Mut wünsche ich Dir und mir für diese Adventszeit: Ein bisschen mehr SEIN LASSEN ist für diesen FREUDENMONAT ist wohl das beste Rezept, um überhaupt in Freudenstimmung und nicht in Stress zu kommen.
Habts fein & auf bald
Die Annabel 💙
„FREIHEIT erlebe ich, wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen; wenn ich aufhöre, meine Stimmung davon abhängig zu machen, was andere tun.“ (aus meinem Buch WILD.FREI.AUTHENTISCH Aufbruch ins Abenteuer Familie)
Hinterlasse einen Kommentar